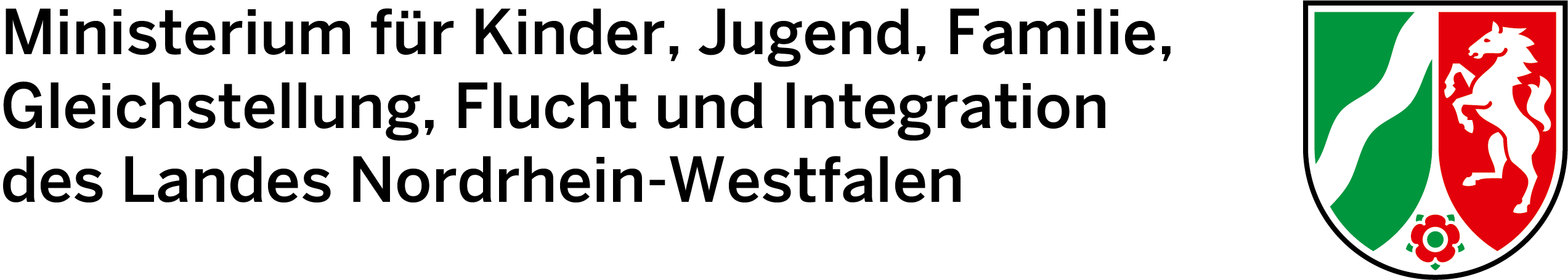Der Hahn kräht. Ausdauernd. Besucher zucken zusammen. Mamudow Keita nicht. Er hat sich an den schneidigen Ton des stattlichen Federviehs längst gewöhnt. Ungerührt schlendert er durch die Beete mit Salaten, Wurzelgemüse und hochstehenden Bohnen. Und fachsimpelt mit Norbert Laurich darüber, ob die Zucchini wohl bald erntereif sind.
Der 23-jährige Mann aus Guinea hätte sich vor einigen Monaten wohl kaum vorstellen können, dass er ein Leben zwischen Hahnenschrei und Kartoffelreihen führen würde. Jetzt möchte er es nicht missen. Es gibt Halt und Struktur in seinem Alltag. „Dreimal die Woche Deutschkurs, zweimal hier auf dem Hof – das ist mein Plan für die Woche“, sagt Keita. Eine feste Wochenstruktur, also: genau das wollte Norbert Laurich erreichen. Geflüchtete mit Duldung wie Keita brauchen neben dem geförderten Sprachkurs ein niederschwelliges Angebot, um sie allmählich mit Leben und Gesellschaft in Deutschland zu vernetzen.
Erst Praktikum – jetzt Minijob
Nach einem sechswöchigen Praktikum hat er Mamudow Keita jetzt als 450-Euro-Kraft eingestellt. Es hätten auch mehr sein können. Doch von sieben anfänglichen Kandidaten blieb nur der Mann aus Guinea dabei. Finanziert wird das Pilotprojekt aus Mitteln des Landesprogramms „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie mit einem einmaligen Zuschuss der Stadt Vreden.
Den Rest nimmt Norbert Laurich auf seine Kappe – als „ehrenamtlicher Arbeitgeber“, sozusagen. Zusammen mit seinem Partner hat er den abgelegenen Hof 2014 übernommen. Er liegt günstig an der sog. Flamingo-Route, einem beliebten Radrundweg im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Es handelt sich um eine Art „Abhol-Hof“, wo Interessierte regionale Produkte selbst ernten können. Ein anderer Teil wird vermarktet bzw. verarbeitet.
Rechnerisch reicht die Fläche für die Versorgung von 30 Haushalten. Doch Laurich will expandieren. Das Projekt soll sich rechnen. Da kommt der Kaufmann in ihm durch. Ein Geschäftsmann mit politischem Engagement.
Traumatische Fluchterlebnisse
Für ihn war es eine Art Rückkehr, denn er stammt aus der Gegend. Zuvor hat er 20 Jahre lang in der Textilindustrie gearbeitet. Als Einkäufer für deutsche Klamotten-Discounter hat er einige der Fluchtländer erlebt, hat die Arbeitsbedingungen gesehen: niedrige Löhne, Kinderarbeit, Gesundheitsgefahren. „Irgendwann konnte ich dieses Maß an Ausbeutung durch unser Konsumverhalten nicht mehr ertragen“, sagt Laurich über den Moment, als er einfach nur „aussteigen“ wollte. „Jetzt will ich etwas zurückgeben“, beschreibt er seine Motivation für die Arbeit mit den Geflüchteten.
Bei einem Besuch in einer Flüchtlings-Unterkunft für afrikanische Geflüchtete lernte er Mamudow Keita vor drei Jahren kennen: ihn und seine Fluchtgeschichte, die eine Ansammlung von Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch ist. Und für ihn wurde klar, warum diese jungen Männer misstrauisch sind. „Wenn Keita erzählt, wie demütigend er seine erste körperliche Untersuchung bei einer Polizeibehörde in Süddeutschland empfand, dann versteht man, warum er deutschen Behörden nicht traut“, ist sich Laurich sicher. „Vertrauen aufbauen“ ist eine Vokabel, die er immer wieder benutzt.
Dezentral: wenig Menschen, weite Wege
Die Umsetzung der Landesprogramme „Gemeinsam klappt’s“ und „Durchstarten“ findet im ländlichen Vreden (Kreis Borken) unter anderen Voraussetzungen statt als in einer Großstadt. „Herausfordernder“, beschreibt es Andrea Dingslaken, die Integrationsbeauftragte der 23.000-Einwohner-Stadt.
Die Unterbringung der Geflüchteten ist dezentral organisiert, verteilt sind sie auf gut ein Dutzend verschiedene Häuser in den einzelnen sog. Kirchdörfern, die für Vreden typisch sind. Oberflächlich scheinen die Geflüchteten somit „verschwunden“ zu sein. „So entstand in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck, wir hätten keine Flüchtlinge in der Stadt und es müsse nichts getan werden“, sagt Sozialdezernent Bernd Kemper.
Umgekehrt ist es „auf dem Land“ schwieriger, die Geflüchteten zu erreichen. Sie wohnen weit außerhalb in Unterkünften, die schlecht angebunden sind mit Bus oder Bahn. „Aber“, so gibt Andrea Dingslaken zu bedenken“, es gibt aus Sicht der Geflüchteten auch keine attraktiven Orte oder Treffpunkte wie in einer Metropole, wo die Menschen automatisch zusammenkommen.“
Ehrenamtliches Engagement ist der Schlüssel
Somit haben die aufsuchende Betreuung und das ehrenamtliche Engagement aus der Bürgerschaft einen hohen Stellenwert. „Ohne dieses Engagement wäre eine so individuelle Betreuung von uns weder auf Kreisebene noch in der Stadt zu leisten“, sagt Sandra Schulz-Kügler vom Kommunalen Integrationszentrum (KI) des Kreises Borken. „Deshalb sind Ansätze wie das Hofprojekt von Norbert Laurich so wichtig und erfolgreich Am Nachmittag sitzt der Genannte mit Mamudow Keita bei einer Tasse Kaffee in der Hof-Küche. „Ich bin sehr dankbar für die viele Hilfe, die ich hier bekomme“, sagt Keita. Es herrscht eine gelöste, fast schon familiäre Atmosphäre. „Er ist als Mensch eine solche Bereicherung für uns“, schwärmt Laurich. Die bisherigen Erfahrungen sind positiv: Keita hilft beim Aussäen, bei der Ernte, kocht Marmelade ein, beschriftet die Gläser, redet im Hofladen mit Besuchern und berechnet die Flächenaufteilung.
Nach einigem Zögern kommt Keita jetzt auch seiner rechtlichen Verpflichtung nach und kümmert sich aktiv um Geburtsunterlagen in seinem Heimatland. Er will seine Identität klären für die deutschen Behörden. „Ein Riesen-Fortschritt“, meint Norbert Laurich. „Es zeigt, dass er allmählich Vertrauen zu uns fasst.“ Und trotzdem weiß er, wie instabil die Situation ist. Am Wochenende ist Keita mit seinen Landsleuten und Freunden in ihrer Unterkunft. „Dort werden dann Horrorgeschichten von drohenden Festnahmen und Abschiebungen erzählt, die für große Unruhe sorgen.“
Ein „Runder Tisch“ für Keita
Inzwischen kümmert sich eine Art „Runder Tisch“ um Mamudow Keita: Stadt, Kreis, Arbeitsagentur und die Coaching-Agentur Berufsbildungsstätte Westmünsterland (BBS) koordinieren ihr weiteres Vorgehen. Auch Coach Nadine Wetzel musste zunächst Vorbehalte bei Keita abbauen und kleine Alltagsprobleme, z.B. mit der Krankenkasse, für ihn lösen. „Als nächstes loten wir aus, in welche Richtung seine beruflichen Interessen gehen“, sagt Wetzel. Ist der Berufszweig identifiziert, wird sie schauen, welche sprachliche Unterstützung Keita dann braucht oder ob Maßnahmen der beruflichen Orientierung durch die Landesprogramme förderfähig sind. Sicher ist für sie: „Mit der Teilnahme am Ackerland-Projekt signalisiert Herr Keita potenziellen Arbeitgebern, wie zuverlässig sie mit ihm planen können.“
Der Hahn schreit immer noch unaufhörlich, als Mamudow Keita und Norbert Laurich erneut durch die Reihen mit Dutzenden verschiedener Tomaten-Sorten gehen. Nicht alle sind gleich erfolgreich angegangen. „Das merke ich mir für nächstes Jahr“, sagt der Mann aus Afrika lachend. „Nächstes Jahr bist Du hoffentlich nicht mehr hier“, antwortet Norbert Laurich spontan. Das klingt wie ein barscher Rauswurf, ist aber nicht so gemeint. Im Gegenteil: „Nächstes Jahr“, so hoffen in Vreden alle, die den Mann aus Guinea kennengelernt haben, ist er bereits in eine Berufsausbildung „durchgestartet“.