
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ist jede ausländische Person, die noch nicht 18 Jahre alt ist und ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen in einen EU-Mitgliedstaat einreist oder ohne Begleitung zurückgelassen wird.
Gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist ein Flüchtling eine Person, „die sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz des Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“.
Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Geflüchteten minderjährig sind. Die meisten Kinder und Jugendlichen flüchten gemeinsam mit ihren Eltern oder Familienangehörigen. Es suchen jedoch auch viele unbegleitete Minderjährige Schutz in Deutschland. Manchmal ist die Flucht im Familienverbund nicht gelungen, in anderen Fällen haben die Eltern nicht über die finanziellen Mittel für eine Flucht der gesamten Familie verfügt oder die Flucht ist durch kinder- und jugendspezifischen Gründe motiviert, z. B. drohende Genitalbeschneidung, Einsatz als Kindersoldat oder sexueller Missbrauch.
Im Spannungsfeld zwischen Jugendrecht und Asylrecht
Schutzsuchende Drittstaatsangehörige müssen in Deutschland ein asyl- und/oder aufenthaltsrechtliches Verfahren durchlaufen – das gilt auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Neben dem Ausländerrecht ist in der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vor allem das Kinder- und Jugendhilferecht von Bedeutung.
Die Rechtsgebiete stehen aufgrund ihrer unterschiedlichen Zielrichtungen teilweise in einem Spannungsverhältnis zueinander. Das Kinder- und Jugendhilferecht hat als Teil des Sozialrechts einen Unterstützungscharakter und mit Blick auf die Zielgruppe zudem einen Schutzauftrag. Das Ausländerrecht ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland (vgl. hierzu auch § 1 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz). Insofern beinhaltet die Umsetzung der Regelungen des Ausländerrechts neben der Ermöglichung eines rechtmäßigen Aufenthalts regelmäßig auch die Sanktionierung und Beendigung illegaler Aufenthalte. Damit sind die Ziele der beiden Rechtsgebiete dem Grunde nach nicht immer miteinander vereinbar. Allerdings gilt auch im Ausländerrecht die Bestimmung der UN-Kinderrechtskonvention, wonach das Kindeswohl bei behördlichen Entscheidungen ein vorrangig zu berücksichtigender Aspekt ist.
Handlungsempfehlungen
Nordrhein-Westfalen hat eine Handreichung zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen herausgegeben, in der die rechtlichen Rahmenbedingungen beschrieben sind, Verfahren erläutert werden und sinnvolle Kooperationen sowie Beispiele guter Praxis aufgezeigt werden. Damit soll Behörden und Akteuren Handlungssicherheit gegeben und darauf hingewirkt werden, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge den notwendigen individuellen Unterstützungsbedarf erhalten, damit das Ziel einer gesellschaftlichen, sozialen und beruflichen Integration sowie einer Verselbständigung erreicht werden kann.
Weitergehende Informationen:
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurde ein bundesweites Verteilverfahren eingeführt, welches eine das Kindeswohl sicherstellende Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gewährleisten und gleichzeitig einen gerechten Belastungsausgleich zwischen den Ländern herbeiführen soll. Mit dem 5. Ausführungsgesetz des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) wurden im Nachzug dieser Änderungen im SGB VIII Regelungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes und im Besonderen für die Verteilung in Nordrhein-Westfalen erlassen.
Das Jugendamt, in dessen Zuständigkeitsgebiet sich ausländische Kinder oder Jugendliche tatsächlich aufhalten, nimmt diese vorläufig in Obhut, sobald deren unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt ist. Im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme ist unter anderem das Alter festzustellen (siehe auch die Arbeitshilfe zur Durchführung von behördlichen Altersfeststellungsverfahren gemäß § 42f SGB VIII (PDF, 356,63 KB)), die rechtliche Vertretung des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings sicherzustellen und auch zu prüfen, ob Gründe gegen eine bundesweite Verteilung sprechen.
Die Jugendämter, denen die Minderjährigen zugewiesen wurden, sind dann für die Unterbringung, Versorgung und pädagogische Betreuung zuständig. Unmittelbar nach der regulären Inobhutnahme beginnt das Clearingverfahren, welches dazu dient, verschiedene Aspekte der Situation der jungen Geflüchteten zu klären und eine umfassende Bestandsaufnahme der persönlichen Situation und damit verbunden der Perspektiven zu erörtern. Dazu gehört auch die Prüfung aufenthaltsrechtlicher Perspektiven.
Das Wohl des Kindes ist bei jeder Entscheidung vorrangig zu berücksichtigen. Um dies gewährleisten zu können, müssen sich die Jugendämter und Ausländerbehörden als Verantwortungsgemeinschaft zur Verwirklichung des Kindeswohls in ausländerrechtlichen Angelegenheiten verstehen. Es empfiehlt sich daher, dass Jugendämter und Ausländerbehörden im Rahmen einer strukturellen Kooperation eng zusammenarbeiten, um die jeweils bestehenden gesetzlichen Aufgaben und Beschränkungen in Einklang bringen zu können.
Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW fördert für die besonders vulnerable Gruppe von jungen Menschen mit Fluchterfahrung Angebote, die gezielt die Bedarfslagen von unbegleiteten und begleiteten Minderjährigen in den Blick nehmen. Das Förderprogramm Integration dient u. a. der Verbesserung des Zugangs von Flüchtlingskindern und -jugendlichen zu den Regelangeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie der Förderung der beruflichen Qualifizierung durch bestehende und neu zu entwickelnde Angebote der Jugendsozialarbeit. Seit dem 1. März 2023 fördert das Landesprogramm „Gemeinsam MehrWert – vielfältige Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen“ Projekte in den Kommunen in NRW, die auf die spezifischen Bedarfe im Kontext Arbeit mit jungen Geflüchteten eingehen. Dieses Förderprogramm soll für die teilnehmenden Kreise und Kommunen und die ausführenden öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe attraktiv und im Sinne ihrer eigenen wertschätzenden Haltung gegenüber geflüchteten Menschen gestaltungsfähig sein. Daher soll dieses Landesprogramm für junge Geflüchtete auch ein Programm für die (jungen) Menschen sein, die in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind und für Vielfalt und Zuwanderung sensibilisiert werden sollen.
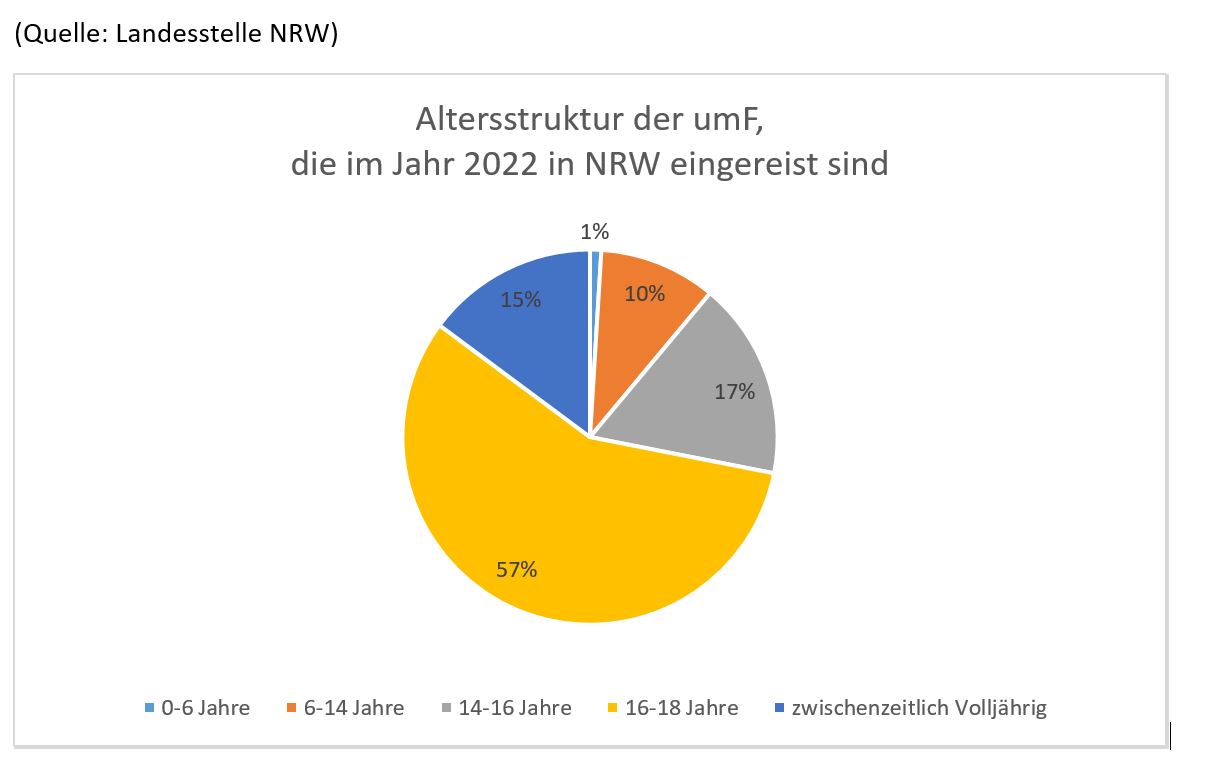
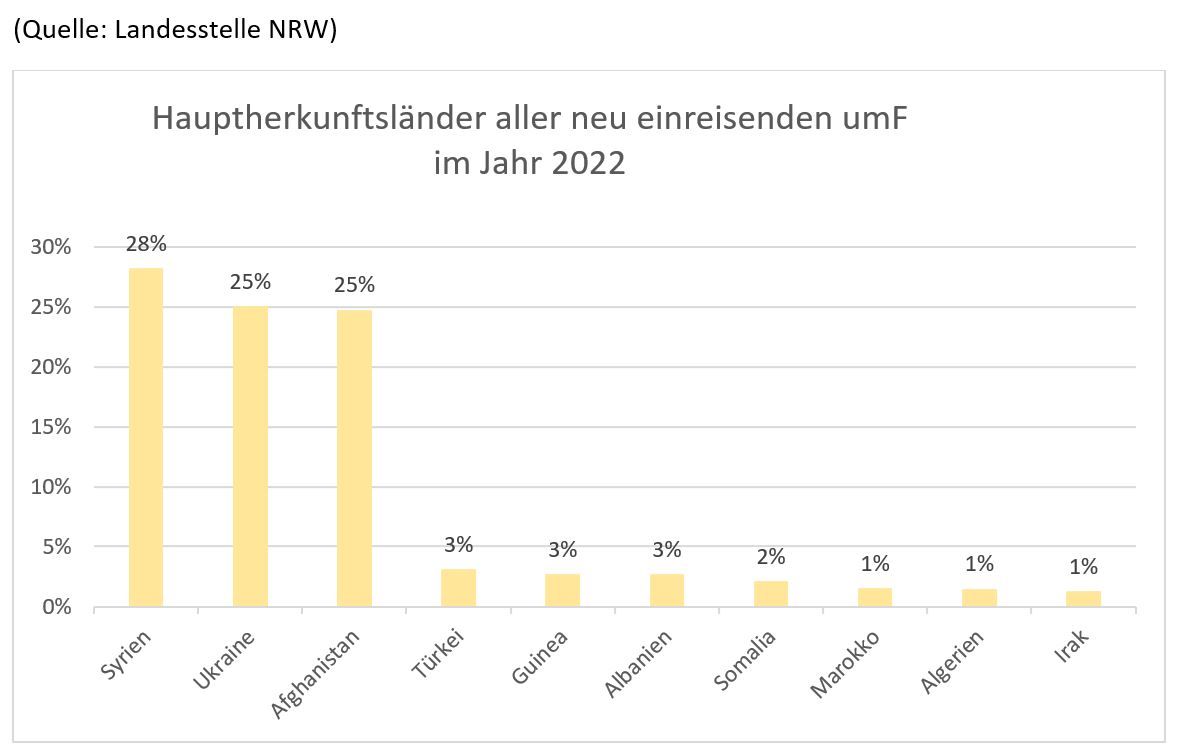
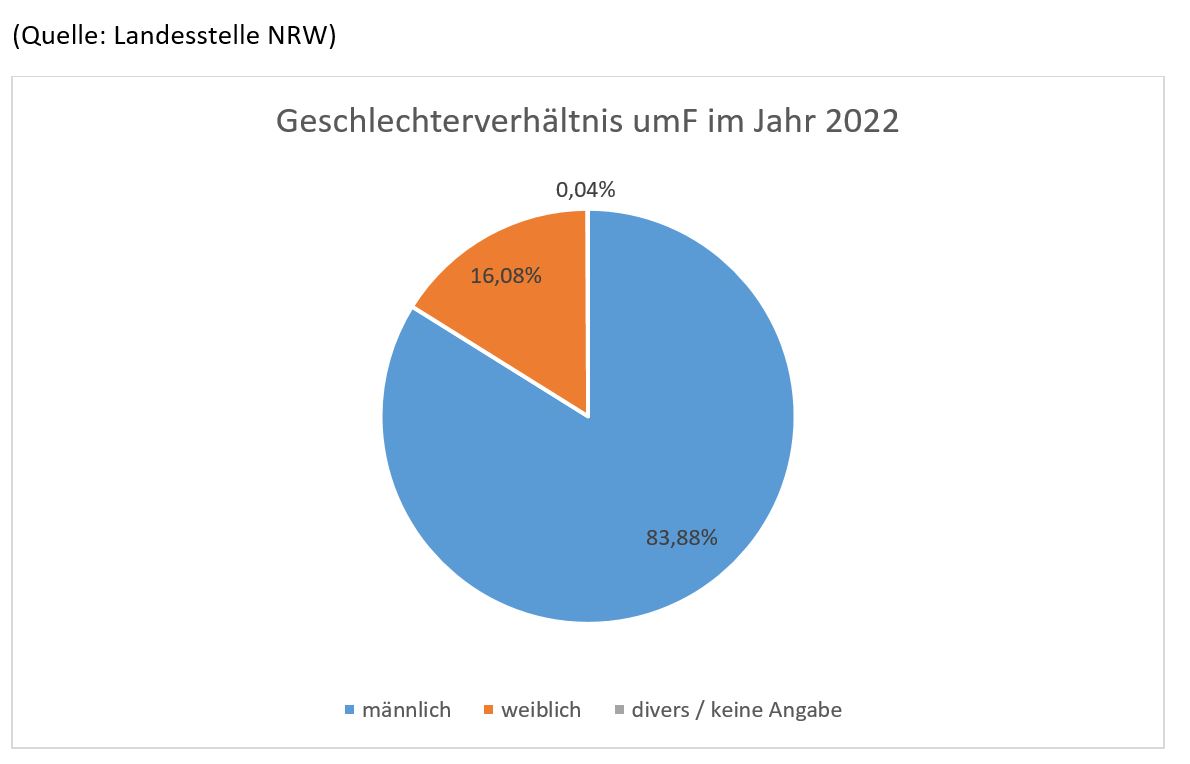
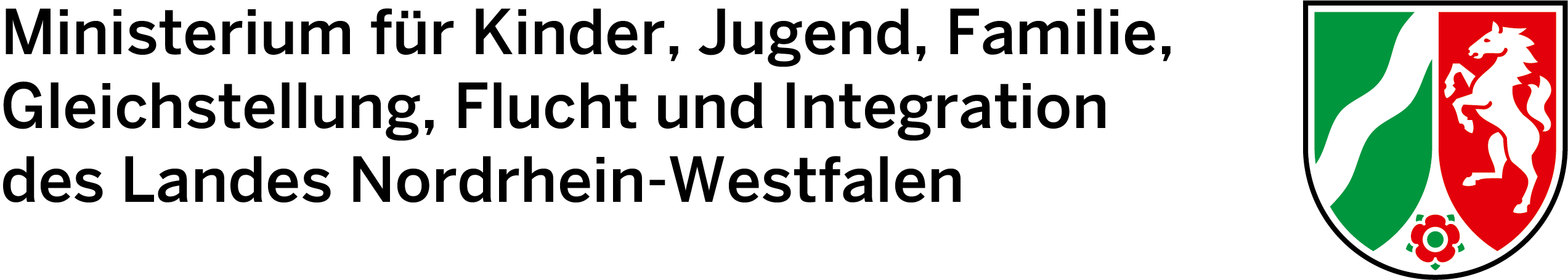



"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: